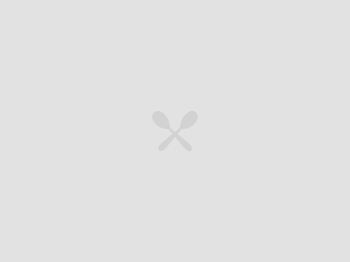Ja: Für alle Nichtwalliser – und sicher auch für die meisten Walliser – ist das Wallis bis heute ein Land der Sagen und Märchen geblieben: In der Verborgenheit seiner Täler sollen Schätze ruhen, von denen oft nur vage Kunde über die Pässe hinaus zum Rest der Welt dringt. Das ist nicht nur beim Wein so, aber gerade auch beim Wein. Mit flüssigem Gold und funkelndem Rubin gefüllte Fässer sollen in Fels- und Gletscherhöhlen ruhen und reifen. Und auf den Hängen des Tals trägt mancher Rebstock Trauben, dessen Herkunft sich im Dunkel der Vorgeschichte verliert...
...und nein: Die Kunde drang aber doch hinaus in die Welt, denn hier im Wallis kreuzen sich eben auch die Wege: leicht und bequem nach Süden und Westen, etwas aufwendiger nach Norden und Osten.
Gerade hier am Kreuzweg zeigt das Wallis jetzt seine Schätze und manch einer im Süden und Westen staunt ob der unerwarteten Pracht und reibt sich die Augen, denn das Märchen wird plötzlich lebendig und eine Geschichte von heute mit echten Fässern, modernen Menschen und offenem Geist. Unterstützt wird dieses lebendige Märchen von traumhaften Hanglagen und Tausenden von Sonnenstunden. Im Verlauf der Jahrhunderte haben sich hier aus allen Richtungen der Windrose Reben angesiedelt, haben eine neue Heimat gefunden und sich spezifisch «walliserisch» weiterentwickelt. Heute wachsen in dem Tal mit seiner nach aussen abgeschlossenen Topografie fast 60 verschiedene Rebsorten, ein ungeheurer Schatz.
Dass dieser Schatz nicht in Vergessenheit geriet, sondern wieder entdeckt und gepflegt und gehegt wurde, ist vor allem einem Mann zu verdanken, den viele den Archäologen des Walliser Weines nennen, Josef-Marie Chanton, den seine Freunde nur «Chosy» nennen. Er hat die Rebberge seiner Heimat abgesucht und da ein paar Stöcke entdeckt, deren Laub im Herbst früher rot wurde und dort einen Weingarten gefunden, der vergessen war und langsam verwilderte. Mit offenen Augen hat er Fundstücke gesammelt und wieder mit Leben erfüllt. So hat er im Verlauf seiner Karriere viele Rebsorten gerettet, die sonst unrettbar verschwunden wären: Gwäss, Himbertscha, Lafnetscha, Eyholzer, Plantscher, wunderbar wird dieses Erbe heute von Sohn Mario Chanton weitergepflegt.

Mario Chanton im Keller der Visper Altstadt

Von links, Chosy Chanton, seine Frau Marlis und Sohn Mario in den Heida-Reben
Annemarie Wildeisen: Mir gefallen die Namen der Weine, zum Beispiel «Lafnetscha». Weisst du, was das bedeutet?
Beat Koelliker: Ich bin ja selbst kein Walliser. Aber wenn die Einheimischen «laffe» sagen, so meinen sie trinken. «Laff nit tscha» bedeutet also «trink nicht schon». Die jungen Beeren dieser Rebsorte sind sehr säurereich, man muss mit der Ernte bis in den Spätherbst warten und auch dann braucht der Wein eine lange Reifezeit im Keller. Man darf ihn also nicht zu früh «laffen». Dann aber geniessen wir kräftige, tief aromatische, sogar an exotische Früchte erinnernde Weine.
Kannst du auch zum Himbertscha eine so schöne Geschichte erzählen?
Dieser Name tönt zwar ganz ähnlich wie Lafnetscha, hat aber eine ganz andere Herkunft: Wahrscheinlich stammt er aus dem Rätoromanischen «im bercla». Das bedeutet in der Pergola.
Und wie schmeckt denn dieser Wein?
Er besticht zuerst durch seine tiefe goldene Farbe. Im Gaumen ist er sehr vielfältig: fast minzeartige Frische paart sich mit einer kräutrigen Erdigkeit und sogar nussige Aromen kann man entdecken. Ohne Chosy Chanton wäre diese Rebsorte wohl für immer verschwunden. Die Welt wäre ohne es zu merken, ein klein wenig ärmer geworden.
Kann man diesen Wein auch noch anderswo kaufen als bei ihm, beziehungsweise seinem Sohn Mario?
Nein, bei Himbertscha, Plantscher und Eyholzer Roter ist Mario der einzige Produzent weltweit.
Das ist ja alles wahnsinnig spannend. Warum sind denn eigentlich diese Rebsorten alle verschwunden?
Das hat eigentlich zwei Gründe: Im 19. Jahrhundert hat ein Wurzelparasit, die Reblaus, den ganzen Weinbau in Europa vernichtet. Erst als man als Gegenmittel herausfand, dass man die europäischen Reben auf reblausresistente amerikanische Wurzelstöcke aufpfropfen konnte, war die Gefahr gebannt. Alle Weinberge mussten damals neu bepflanzt werden, und das hat man natürlich nur mit einer Auswahl an Rebsorten gemacht. Dabei gingen wohl Hunderte von wertvollen Sorten verloren.
...und zweitens?
Vor der Reblauskatastrophe vermehrte man die Stöcke ganz einfach, indem man eine Rute des Nachbarstockes in die Erde vergrub. So entstand in einem Weinberg im Verlauf der Jahrhunderte eine grosse Vielfalt an Rebsorten. Nach der Katastrophe musste jede Neupflanzung genau geplant werden, was weiter zu einer Verarmung der Sorten geführt hat.